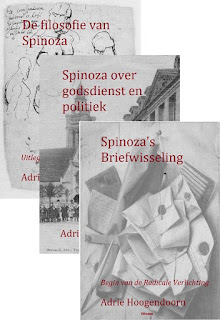Max Grunwald (1871 - 1953) Gekrönte Preisschrift "Spinoza in Deutschland"
“Ohne Spinoza kein Goethe. Ohne Goethe kein Spinoza
Max Grunwald *)
In diverse blogs heb ik er al eens gebruik van gemaakt
en ernaar verwezen, maar een apart blog erover had ik nog niet. Ik maak het nu
eindelijk, mede om zo het boek zelf sneller te vinden.
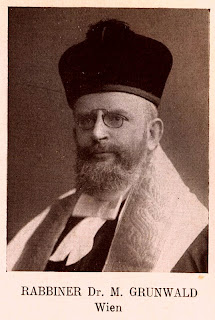 Grunwald, geboren in Zabrze in het Pruisische Silezië,
studeerde aan de universiteit van Breslau waar hij in 1892 promoveerde tot
doctor in de filosofie op Das Verhältnis
Malebranches zu Spinoza [Breslau, Schatzky, 1892]. Tegelijk bezocht hij in dezelfde
plaats het Jüdisch-Theologische Seminar en werd rabbijn. Hij was vanaf
1895 rabbijn in Hamburg en vanaf 1903 in Wenen. Ondertussen schreef hij over
joodse geschiedenis en over joodse volkerenkunde. In 1897 richtte hij de Gesellschaft
für Jüdische Volkskunde op en werd in 1898 hoofdredacteur van de Mittheilungen ervan.
Grunwald, geboren in Zabrze in het Pruisische Silezië,
studeerde aan de universiteit van Breslau waar hij in 1892 promoveerde tot
doctor in de filosofie op Das Verhältnis
Malebranches zu Spinoza [Breslau, Schatzky, 1892]. Tegelijk bezocht hij in dezelfde
plaats het Jüdisch-Theologische Seminar en werd rabbijn. Hij was vanaf
1895 rabbijn in Hamburg en vanaf 1903 in Wenen. Ondertussen schreef hij over
joodse geschiedenis en over joodse volkerenkunde. In 1897 richtte hij de Gesellschaft
für Jüdische Volkskunde op en werd in 1898 hoofdredacteur van de Mittheilungen ervan.
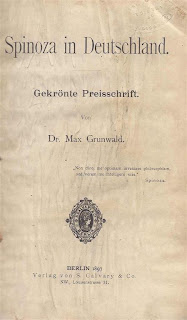 Én hij deed mee aan een in 1893 uitgeschreven schrijfwedstrijd
over Spinoza die hij won: Spinoza in
Deutschland, [Berlin, 1897]
Én hij deed mee aan een in 1893 uitgeschreven schrijfwedstrijd
over Spinoza die hij won: Spinoza in
Deutschland, [Berlin, 1897]
De tekst is te vinden op archive.org.
Op de titelpagina als motto Spinoza's uitspraak aan
Albert Burgh: “Non dico me optimam invenisse philosophiam, sed veram me
intelligere scio.”
Het meest komen we over prijsvraag en resultaat te weten uit delen van het juryoordeel dat in het Voorwoord is opgenomen:
Vorwort
Zur Rechtfertigung eines Vorwortes diene das Folgende.
In No. 22 der „Oesterreich. Wochenschrift" Jhrgg. 1893 fand sich ein
Preisausschreiben, welches die Aufgabe stellte: „Einfluss Spinozas auf deutsche
Denker und Dichter. Die Preisschrift soll nicht bloss den bereits ausgeübten
und noch fortwirkenden Einfluss Spinoza's auf deutsche Denker und Dichter auf
Grund der eigenen Forschungen des Verfassers nachweisen, sondern auch die
Ansichten von Schriftstellern in den letzten zwei Jahrhunderten über diesen
Punkt den Lesern mittheilen." Die Arbeiten sollten „bis längstens 31.
Dezember 1894" eingeliefert werden.
Auf diese Anzeige wurde der Verf. erst nach Wochen aufmerksam.
Ausserdem waren bis gegen Ende 1893 eine zweite Preisschrift, sowie andere
Arbeiten zu erledigen. Es gelang jedoch, die vorliegende Lösung der Preisfrage
zur rechten Zeit einzureichen.
Die Urteile der Preisrichter, welche, laut einer
Anzeige vom 16. April 1896, die Krönung der Arbeit mit dem Preise zur Folge
hatten, lauteten im wesentlichen wie folgt:
1. Die Arbeit geht „über das Thema der Preisaufgabe
weit hinaus. Sie behandelt nämlich nicht nur diesen Einfluss (Spinozas), sondern
enthält vielmehr eine vollständige Geschichte des Spinozismus in Deutschland.
Dieser erweiterten Aufgabe ist der Verfasser mit grossem Eifer und umfassender
Sachkenntnis nachgekommen. Er ist ein gründlicher Kenner sowohl der Geschichte
der Philosophie, als auch der modernen Literaturgeschichte und ein Mann von
sicherem, selbständigem und gereiftem Urteil. Mit seltenem und höchst
anerkennenswertem Fleisse hat er die ganze umfangreiche, auf seinen Gegenstand
bezügliche Literatur in einer Weise durchforscht und benützt, wie sie in
derartigen Monographien nicht häufig angetroffen wird. Der mit Glück erfasste
und durchgeführte Gedanke, die Wandlungen in der Erkenntnis und Auffassung Spinozas
in engem Zusammenhang mit dem Umänderungsprozesse der modernen Welt-Anschauung
selbst in Verbindung zu bringen, hebt die Arbeit über das Durchschnittsmass
literarhistorischer Leistungen hinaus und gewährt ihr die Bedeutung eines
Beitrages zur modernen Cultur-Geschichte. Mangelhaft erscheint mir die
Untersuchung der Beziehungen Spinozas zur modernen Rechtslehre und Politik.
Dass z. B. Spinozas Einfluss mitgewirkt hat an dem Aufbau der socialistischen Geschichtsconstruction,
die alles Recht aus socialen Machtverhältnissen abzuleiten bestrebt ist, findet
keine Erwähnung, trotzdem der Weg von Spinoza über Hegel zu Karl Marx und seiner
Schule klar zu Tage liegt.
Als ein schwerwiegender Fehler aber muss es bezeichnet
werden, dass die Lehre Spinozas als bekannt vorausgesetzt wird, so dass die
Arbeit sofort in medias res geht. . . Wenn nun der Verfasser sich hie und da
auch kritisch äussert, so ist doch ein zusammenhängendes Bild seiner Erkenntnis
Spinozas aus seinen Ausführungen nicht zu erkennen.
Die Sprache der Abhandlmng ist im Allgemeinen klar und
fliessend. . . .
2. Die eingelaufene Arbeit kann unbedenklich als
gelungen und des ausgesetzten Preises würdig erklärt werden. Der Verfasser hat
keine Mühe gescheut, eine kaum übersehbare Literatur bewältigt, hie und da auch
handschriftliche Quellen aufgespürt und verwertet.
Das weit ausgedehnte Material hat ihn eine reiche
philosophische Bildung und eindringendes selbständiges Urteil verarbeiten und
zu einem umfassenden, zumeist auch in geschickter Darstellung ausgeführten
Gesamtbilde vereinigen lassen.
Spinozas Einfluss auf das deutsche Geistesleben stand
in seinen Grundzügen zwar seit langer Zeit fest. . . Allein nicht nur für die frühere
Epoche, in der dieser Einfluss sich betätigt hat, sind wichtige Zeugnisse
aufgespürt oder neu beleuchtet worden; auch in Betreff jener Denker, deren
Beeinflussung durch Spinoza niemals zweifelhaft war, ist die Art, wie dieser
Einfluss sich geltend machte, wie er sich mit anderen Bildungsfactoren verflochten,
wie er in die Breite und Tiefe des geistigen Lebens der deutschen Nation gewirkt
hat, mit dankenswerter Gründlichkeit erforscht und mit anschaulicher Klarheit
dargestellt worden. Dabei verdient es besondere Anerkennung, dass der Verfasser
neben den Philosophen auch die Dichter, einen Grillparzer, Lenau u. s. w. in
den Bereich seiner Untersuchung gezogen hat.
Doch sollen auch die Mängel der im grossen und ganzen so
rühmenswerten Arbeit nicht verschwiegen werden. Es wäre erwünscht gewesen, wenn
der Verfasser der Geschichte des Spinozismus in Deutschland ein, wenn auch
kurzgegefasstes Bild dieser Lehre selbst vorangeschickt hätte. Er übt an Spinozas
System gelegentliche Kritik, er weist diese oder jene Auffassung
spinozistischer Grundlehren als verfehlt zurück, ohne doch seine eigene Ansicht
von dem wahren Wesen der spinozistischen Doctrin darzulegen oder zu begründen.
Als einen zweiten Mangel, der mit leichterer Mühe vermieden werden konnte,
möchten wir das Folgende bezeichnen. Das Tatsächliche und die Meinungen über das
Tatsächliche werden keineswegs überall reinlich geschieden; auch die
Folgeordnung, in der Beides behandelt wird, erscheint mitunter als eine wenig angemessene
. . . Ein anderes, aber ein noch verzeihlicheres Gebrechen der Arbeit ist es,
dass der Verfasser sich, je mehr er dem Ende der Abhandlung sich nähert, mehr
und mehr in's Detail verliert und das Wichtige vom Unwichtigen immer weniger zu
sondern versteht. Dieser Fehler darf wol mit Fug auf Rechnung der bei einer so
umfangreichen und zugleich in bemessener Frist zu vollendenden Untersuchung
kaum vermeidlichen Uebermüdung gesetzt werden . . . Durchaus erwünscht wäre es,
dass der Verfasser, sobald er an die Drucklegung seiner Arbeit schreitet,
manche Auswüchse seiner in manchen Partien . . allzu blühenden Darstellung
beschneide, auch hie und da ein stilistisches Versehen, deren Referent sich
mehrere angemerkt hat, rechtzeitig berichtige.
3. Die umfangreiche Abhandlung ist das Ergebniss einer
sehr fleissigen und ausgedehnten Bearbeitung der gestellten Aufgabe. Allerdings
hat der Verfasser den Einfluss Spinozas vornehmlich für die „Geschichte des
modernen Bildungsgedankens", in’s Auge gefasst. Schon in der Anlage der
Arbeit zeigt sich diese Beschränkung. Der Verfasser legt seiner geschichtlichen
Darstellung und Beurtheilung nicht zu Grunde eine eigene, wenn auch noch so
kurze Darstellung des Spinozismus, seines Gehaltes und seiner
Enstehungsgeschichte, sondern er beginnt sogleich mit der Geschichte von
Spinoza's Einfluss. Der philosophische Wert der Arbeit ist hiernach
eingeschränkt und beeinträchtigt.
Indessen für die Zwecke eines literargeschichtlichen
Compendiums dieses so höchst wichtigen Bildungs-Factors ist die Arbeit von anerkennenswerthem
Nutzen. Der Verfasser hat alle in Betracht kommenden Nachwirkungen auf diese
Quelle hin geprüft und mit Gründlichkeit und Ausführlichkeit die Belege
beigebracht.
Wenn, wie nach der Fassung der Aufgabe vermuthet
werden darf, die Tendenz derselben mehr auf eine literargeschichtliche Würdigung
gerichtet ist, als auf eine selbständige philosophische Untersuchung und
Abschätzung des spinozischen Einflusses in logisch-kritischer, wie in ethischer
Hinsicht, so möchte ich kein Bedenken tragen, der Arbeit den Preis
zuzuerkennen."
Die in diesen Urteilen enthaltenen dankenswerten Winke
hat der Verfasser bei der Drucklegung der Arbeit zu nutzen sich bemüht, soweit
ihr Charakter und ihr Umfang dadurch nicht wesentliche Aenderungen erlitten. Es
ist, abgesehen von einigen literargeschichtlichen Zusätzen, welche die
inzwischen erschieneneFachliteratur erforderte, im allgemeinenwenighinzugefügt worden.
Nur dem, mit Uebereinstimmung geäusserten, Wunsche einer Skizzirung des
Spinozismus zu entsprechen, soll an dieser Stelle, dem Rahmen der ganzen Arbeit
gemäss, in möglichst volkstümlicher Weise versucht werden.
De reviewer ALFRED H. LLOYD [in: The American Journal
of Theology, Vol. 3, No. 2 (Apr., 1899)] sluit zich aan bij de kritiek van de
jury: té weinig over wie Spinoza was en wat hij leerde. Het is te materieel en
biedt te weinig denken: “too objective, or, let us say, too
"scientific." It is seriously lacking in spontaneity.”
Hij begint met wat statistiek die een beeld geeft: “it treats individually,
under separate headings, the Spinozism or anti-Spinozism of one hundred three
persons and collectively the relations to Spinoza of more than a dozen groups
or schools. To each separate heading an average of a little over two pages has
been allowed, but such as Mosheim, Rappolt, Stolle, Brucke, Arnold, Jean Paul,
Haeckel, and Geiger get only a few lines, some only three or four, while
Leibnitz gets seven pages, Edelmann over twelve, Herder over six, Goethe nearly
ten, Schiller six, Kant over five, Fichte six, Auerbach four, Schleiermacher
six, Schelling over eighteen, Hegel nine, Herbart over two, Schopenhauer and
von Hartmann about six each, and Nietzsche about three.“
* * *
Op letterlijk het laatste nippertje ontkwam Max Grunwald aan Nazi-vervolging door in 1938, het jaar van de Reichskristallnacht, naar Jerusalem te emigreren. Hem redde het feit dat hij, ondanks dat onder rabbijnen het zionisme niet populair was, hij toch minstens een beetje (als dat zo gezegd kan worden) zionist was.
* * *
Heinrich Scholz (Hrsg.), is in Die Hauptschriften zum Pantheismusstreit zwischen Jacobi und Mendelssohn [Berlin: Reuther & Reichard, 1916 – archive.org] in een voetnoot in de Einleitung op pag. XLI niet erg te spreken over Grunwald:
“Die mit kompilatorischem Fleiß verfaßte Sammelarbeit von Max Grunwald, Spinoza in Deutschland 1897, kann bei ihrem völligen Mangel an Gesichtspunkten und Durcharbeitung des Stoffes höchstens als Vorarbeit anerkannt werden. — Man vergleiche noch den sorgfältig bearbeiteten Abriß einer Geschichte des spinozistischen Gottesbegriffes bei J. H. Loewe, Die Philosophie Fichtes nach dem Gesamtergebnisse ihrer Entwicklung und in ihrem Verhältnisse zu Kant und Spinoza 1862 S. 271 — 286 (doch sind die Ausführungen über die Nachwirkungen der Jacobischen Spinoza-Auffassung bei Schelling und Hegel S. 283 f. mit größter Vorsicht aufzunehmen); ferner den Abschnitt über die neuere Entwicklung des Spinozismus bei F. Erhardt, a. a. 0. S. 35 — 66.
______________
Bronnen
*) Geciteerd door David Wertheim, Salvation Through Spinoza: A Study of Jewish Culture in Weimar Germany [Brill, Leiden, 2011 - cf hier]
de.wikipedia over Max Grunwald
Jewish Encyclopedia over Max Grunwald
Lemma 2207 Grunwald, Max, Dr. in: Michael Brocke, Julius Carlebach, Carsten Wilke, Katrin Nele Jansen (Hrg], Biographisches Handbuch der Rabbiner, Volume 2. Walter de Gruyter, 2004 [books.google]
Review by Alfred H. Lloyd
Herkomst foto van Max Grunwald van hier - daar meer over Grunwald's Geschichte der Wiener Juden bis 1914
James R. Dow, Hannjost Lixfeld (Eds.), “The” Nazification of an Academic Discipline: Folklore in the Third Reich. Indiana University Press, 1994 [via books.google te lezen hoe er een eind kwam aan de door Grunwald begonnen joodse volkskunde]