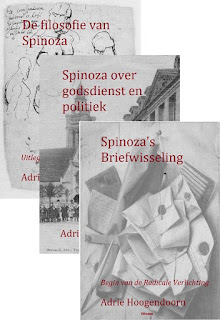Filosofie van het lichaam
 In het Duits is onlangs, in april, een vertaling verschenen uit het Frans (niet aus dem Italienischen, zoals Dradio meldt) van Michela Marzano, La philosophie du Corps ( PUF, 2007) :
In het Duits is onlangs, in april, een vertaling verschenen uit het Frans (niet aus dem Italienischen, zoals Dradio meldt) van Michela Marzano, La philosophie du Corps ( PUF, 2007) :
Michela Marzano: Philosophie des Körpers. Aus dem Französischen von Elisabeth Liebl. Diederichs Verlag, München 2013, 142 Seiten, €14,99 [PDF met inhoudsopgave en inleiding].
Ook Spinoza's filosofie wordt door haar behandeld. Ze baseert zich sterk op de fenomenologie van Merleau-Ponty.
Ik breng deze informatie in het verlengde van de discussie op dit blog over 'denkende materie' [cf blog]. Het eerste boek van Michela Marzano had als titel Penser le corps [PUF, 2002], hetgeen toch heel anders klinkt dan b.v. la pensée du corps.
Ik neem hier een paragraaf uit die inleiding over:
I. Der zweideutige Status des menschlichen Körpers
Ein Problem, mit dem sich Philosophen konfrontiert sehen, die sich für den Körper interessieren, ist seine ambigue Existenz, die sich weder auf das Dasein eines einfachen Dinges beschränken lässt noch auf seinen Status als denkendes Bewusstsein.
»Das Wort ›existieren‹«, schreibt Merleau-Ponty, »hat zweierlei Sinn, und zwar nur zweierlei Sinn: Existenz als Ding und Existenz als Bewusstsein. Dagegen enthüllt uns die Erfahrung des eigenen Leibes eine Weise des Existierens, die zweideutig ist.«
Denn tatsächlich ist der menschliche Körper zunächst ein »materielles Objekt« und als solches dem »Werden« und »Erscheinen« unterworfen. Daher ist er auf konzeptueller Ebene so schwer zu fassen, daher stößt er als Gegenstand philosophischen Interesses nicht selten auf Ablehnung. Doch ist er auch das, »was wir sind« und als solches Ausweis unserer Menschlichkeit und unserer Subjektivität. Ebendeshalb lohnt es sich, über ihn nachzudenken, wenn wir zu begreifen versuchen, wer oder was der Mensch ist. Wenn wir also davon ausgehen, dass der Körper ein »Objekt« ist, heißt das nicht notwendigerweise, dass er ein Ding wie andere Dinge ist, außer natürlich, wir ziehen die Möglichkeit in Betracht, dass wir uns seiner entledigen könnten. Aber kann man denn den Körper tatsächlich auf Distanz halten? Die Erkenntnis der Unmöglichkeit der Distanzierung nimmt ein Denken vorweg, das den Körper als Subjekt sieht, wie dies in der postkantischen Philosophie der Fall ist. Allmählich setzt sich die Vorstellung durch, dass der Körper eben nicht nur Objekt ist. Denn das, was wir »Körper« nennen, ist nicht nur ein simples Ding, Gegenstand einer Betrachtung, einer Tat. Er ist vielmehr in die Betrachtung, in die Tat eingebunden. So rückt der Körper bei Merleau-Ponty ins Zentrum der philosophischen Betrachtung, wird zum Herzstück des »an sich« und »für sich« jedes Einzelnen: eine Spur in der Welt, ein »berührendes Berührtes«, »sehend und sichtbar«. Daher entwickelte sich die Frage nach dem Körper / Fleisch zu einer der wesentlichen Fragen im 20. Jahrhundert, wobei das Fleischliche die grundlegende Seinsweise der menschlichen Existenz darstellt.
Obwohl die klassischen Dualismen an Aktualität verloren haben, bleibt der Körper eine Wirklichkeit, die viele glauben sich buchstäblich vom Leib halten zu können – entweder durch die neuen Möglichkeiten der Technik oder durch die Allmacht eines körperlos gedachten Willens. Aus ebendieser Haltung gewinnt die Philosophie des Körpers ihre Bedeutung. Sie versucht, die gegenwärtige Realität zu entschlüsseln, sie fragt nach dem Sinn der leiblichen Existenz des Menschen. Und das ist keine leichte Aufgabe, wenn man sich die Widersprüche ansieht, die der Mensch im Hinblick auf seine Körperlichkeit an den Tag legt. Einerseits scheint der Körper endlich in seiner Materialität akzeptiert zu sein, in seinem Leiden, seinen Bedürfnissen, auch seiner Schönheit, da er ja Gegenstand eines veritablen Kults ist. Andererseits wird er in den Dienst unserer kulturellen und sozialen Konstrukte gestellt.
Die Diskurse über den Körper scheinen in einer Sackgasse zu stecken: Einerseits betrachtet man ihn als Materie, die sich ganz nach – nie befriedigter – Lust und Laune formen lässt. Andererseits ist er es, der uns dem Schicksal, dem Tod unterwirft. Natürlich ist er weitgehend als fleischliches Substrat des Individuums, als Sitz unserer persönlichen Erfahrungen, anerkannt. Doch wird er auch – und das sehr viel häufi ger – als Objekt der Repräsentation, der Manipulation, der Formung und der sozialen beziehungsweise medizinischen Technik gesehen.
Die frühere Zweideutigkeit von Körpersubjekt und Körperobjekt wird neu interpretiert. Da stehen sich gegenüber: die Körpertotalität, die den Leib mit dem Subjekt, der Person, einfach gleichsetzt, und das Bild vom Körper als Ansammlung von Organen, denen ebenfalls nur Dingcharakter zugebilligt wird. Im ersten Fall wird die Persönlichkeit materialistisch auf das körperliche Sein verengt, im zweiten Fall verleitet die scheinbare Andersartigkeit des Körpers zur Gewissheit, einen Körper objekthaft zu besitzen, sodass der Mensch sich in körperlicher Hinsicht als das »Andere« erlebt. Wie aber können wir diese Paradoxa auflösen?