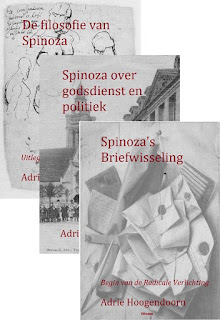Fritz Mauthner (1849 – 1923) Der Freidenker vom Bodensee
 In aanvulling op het blog dat ik op 2 mei 2009 over Fritz Mauthner en zijn waardering voor Spinoza had, kan ik nu meedelen dat de gigantische studie die hij in het laatste traject van zijn leven over de geschiedenis van het atheïsme schreef en waarin hij zijn taalkritische analyses toepaste, waartoe zijn leraar Ernst Mach hem had aangespoord, Der Atheismus und seine Geschichte im Abendland [4 delen, 1921–23] recent opnieuw is uitgegeven.
In aanvulling op het blog dat ik op 2 mei 2009 over Fritz Mauthner en zijn waardering voor Spinoza had, kan ik nu meedelen dat de gigantische studie die hij in het laatste traject van zijn leven over de geschiedenis van het atheïsme schreef en waarin hij zijn taalkritische analyses toepaste, waartoe zijn leraar Ernst Mach hem had aangespoord, Der Atheismus und seine Geschichte im Abendland [4 delen, 1921–23] recent opnieuw is uitgegeven.
 Hij had zich ervoor teruggetrokken in een schitterend gelegen huis in de voormalige bisschopsresidentie in Meersburg aan het Bodenmeer met zijn 23-jaar jongere vrouw Hedwig Straub die hij had leren kennen nadat hij zich in 1905 in Freiburg gevestigd had. Zij verwierven in 1909 dit huis met z’n prachtige uitzicht, gingen er direct wonen en trouwden een jaar later. Daar dus deed hij de studies die nodig waren voor dit herculeswerk over het atheïsme vanaf de tijd der antieken tot de tegenwoordige tijd.
Hij had zich ervoor teruggetrokken in een schitterend gelegen huis in de voormalige bisschopsresidentie in Meersburg aan het Bodenmeer met zijn 23-jaar jongere vrouw Hedwig Straub die hij had leren kennen nadat hij zich in 1905 in Freiburg gevestigd had. Zij verwierven in 1909 dit huis met z’n prachtige uitzicht, gingen er direct wonen en trouwden een jaar later. Daar dus deed hij de studies die nodig waren voor dit herculeswerk over het atheïsme vanaf de tijd der antieken tot de tegenwoordige tijd.
Ludger Lütkehaus, filosoof en literatuurwetenschapper uit Freiburg, zet zich er al jaren voor in om het werk van Mauthner weer beschikbaar te maken. Onlangs redigeerde hij Mauthners magnum opus.
„Es ist ein inhaltlich schwergewichtiges, stilistisch, sprachlich und formal jedoch erstaunlich leichtfüßiges Jahrhundertwerk über die ebenso wechselvolle wie spannende Entwicklung der abendländischen Freidenkerei, das der Leser da in Händen hält. Eine Ideengeschichte des Widersprechens, des Abweichens, des emanzipierenden Infragestellens, die weder sauertöpfisch-apodiktisch daherkommt, noch den Kardinalfehler vieler Anti-Dogmatiker begeht, die beim Niederreißen festgefügter Lehrgebäude nur neue Denkbarrieren auftürmen. Vollkommen unverständlich, wie ein solches im besten Wortsinn aufklärerisches und aufgeklärtes Bravourstück einem fast hundertjährigen Vergessen anheim fallen konnte.
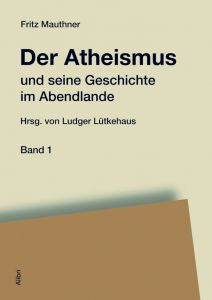 Fritz Mauthner: Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande. Herausgegeben und eingeleitet von Ludger Lütkehaus. Alibri-Verlag, Aschaffenburg 2011. Vier Bände, 1975 Seiten, 179 Euro.
Fritz Mauthner: Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande. Herausgegeben und eingeleitet von Ludger Lütkehaus. Alibri-Verlag, Aschaffenburg 2011. Vier Bände, 1975 Seiten, 179 Euro.
Mauthner durchdringt seinen gewaltigen Untersuchungsgegenstand mit ebenso imponierender wie souveräner Gelehrsamkeit. Angefangen bei der pelagianischen und manichäischen Ketzerei, derer sich die christlich-kirchenväterliche Rechtgläubigkeit der Spätantike zu erwehren hatte, bis hin zu Friedrich Nietzsche, dem vogelfreien Verkünder des Gottesmordes, entwirft Mauthner auf fast 2000 Seiten ein faszinierendes Panoptikum jenes Zweigs der abendländischen Geistesgeschichte, an dessen Endpunkt die Überwindung des "gewaltigsten Gedankenwesens, das in der Menschheit gewirkt hat" steht. Dass in Mauthners Genealogie der Gottesbefreiung auch durchaus gottnahe Geister wie Johannes Hus, Martin Luther, Erasmus von Rotterdam, Pierre Bayle, Baruch de Spinoza, Wilhelm von Ockham oder Meister Eckhart ihren Platz finden, überrascht. Mancher Leser wird darin gar einen unzulässigen Akt atheistischer Vereinnahmung sehen. Aber Mauthner hat diese Schwachstelle im Blick, wenn er beinahe apologetisch schreibt: "Die Geschichte der Befreiung vom Gottesbegriff wäre aber kläglich lückenhaft, wenn ich mich auf die Reihe der dogmatischen Gottesleugner beschränkt hätte". Ganz sicher hat die "Halbheit der Freidenkerei" bei so manchem kritischen Denker zumindest bis zur Aufklärung mit der Sorge um seine körperliche Unversehrtheit zu tun. Und mit der Abhängigkeit von der Sprache der Zeit, die im abendländischen Kulturraum nun einmal eine gemeinsame christliche Sprache mit ihrer ganz eigenen, kulturell gewachsenen, aber eben auch bedingten und damit wandelbaren Begrifflichkeit war und ist. Die Geschichte des geistigen Befreiungskampfes geht somit einher mit der nominalistischen Entzauberung der Welt – der Sprachkritiker lässt grüßen.“