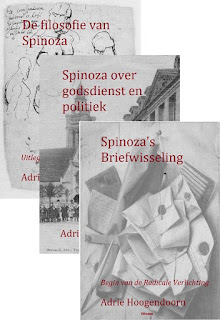Op weg naar de cursus over de PPC [3] het gaat om "eine kritische Interpretation"
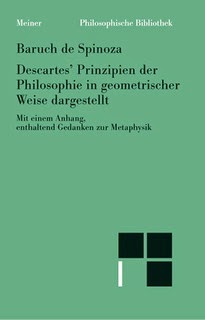
 Wolfgang Bartuschat verzorgde in 2005 voor de reeks van
de Duitse uitgever Felix Meiner, Baruch de Spinoza Sämtliche Werke, Bd. 4., een nieuwe vertaling van
Descartes' Prinzipien der Philosophie in geometrischer Weise dargestellt [cf.]
Wolfgang Bartuschat verzorgde in 2005 voor de reeks van
de Duitse uitgever Felix Meiner, Baruch de Spinoza Sämtliche Werke, Bd. 4., een nieuwe vertaling van
Descartes' Prinzipien der Philosophie in geometrischer Weise dargestellt [cf.]
Uit Wolfgang Bartuschat’s "Einleitung" neem ik hier de volgende passage over.
“Der eigentümliche Reiz unserer Schrift liegt darin, daß sie eine Auseinandersetzung Spinozas mit Descartes auf dem Boden der Cartesischen Philosophie und mit der spätscholastischen Metaphysik auf dem Boden von deren Begrifflichkeit enthält. Sie vermag an den referierten Systemen auf ihnen immanente Probleme zu verweisen und darin deutlich zu machen, daß sie nach einer andersartigen Bearbeitung verlangen. Indem das Referat so, zumindest teilweise, auf Spinozas eigene Position verweist, ist die vorliegende Schrift das Beispiel einer Textexegese, die von einem fortgeschrittenen Standpunkt aus an einem gegebenen Text Implikationen aufweist, die über die im Text enthaltene Sache hinaus auf einen höheren Standpunkt weisen, ohne daß dieser von außen in die Sache hineingetragen würde, der sich vielmehr als eine Fortentwicklung der Sache selbst erweist. Aber unabhängig von einem solchen Bezug darf als eine bedeutende Leistung dieser Schrift auch angesehen werden, daß in ihr Spinoza Spannungen in den von ihm referierten Positionen aufzuzeigen vermag, die ihnen nicht äußerlich sind, sondern tatsächlich innewohnen. Etienne Gilson, ein glänzender Kenner der mittelalterlichen und Cartesischen Philosophie, hat Spinoza deshalb eine unvergleichliche Qualität als Kommentator attestieren wollen. [1]
Allerdings werden wir heute die vorliegende Schrift nicht als eine Kommentar-Schrift lesen wollen, die uns den Cartesianismus zu erschließen hilft, sondern als einen Beitrag zum Verständnis der Philosophie Spinozas, die in dessen Hauptwerk, in der 1677 veröffentlichten Ethica, ihre abgeschlossene Gestalt gefunden hat, wobei zu beachten ist, daß Spinoza sie zum Zeitpunkt des Niederschreibens der Descartes-Schrift in großen Teilen schon konzipiert hatte. Solange seine eigene Philosophie noch unbekannt war, konnte Spinoza als ein Cartesianer unter anderen angesehen werden, der nichts anderes tue als seinen Meister zu paraphrasieren, wie es Leibniz in einem Brief an Thomasius vom April 1669 formuliert hat.[2] Wer seine Philosophie zwar kannte, aber verdammte, konnte andererseits bedauern, daß Spinoza nicht bei den Cartesischen Prinzipien der Philosophie stehengeblieben war, denn »dann hätte man ihn noch für einen ordentlichen Philosophen passieren lassen können«.[3] Beide Qußerungen verkennen freilich den eigentümlichen Charakter unserer Schrift, daß sie eben nicht nur das bloße Referat einer Cartesischen Schrift ist, sondern dessen kritische Interpretation. Gewiß gerät diese Kritik erst unter Hinzunahme der ausgearbeiteten Ethik in aller Deutlichkeit in den Blick; doch heißt das nicht, daß man die Schrift in erster Linie unter einem entwicklungsgeschichtlichen Gesichtspunkt zu lesen habe. Denn die Übernahme Cartesischer Positionen ist keineswegs so zu verstehen, daß Spinoza hier in Cartesischen Theoremen befangenen sei, aus denen er sich noch nicht habe befreien können.
[1] 3 Spinoza interprète de Descartes. In: Chronicon Spinozanum III, Den Haag 1923, S. 68–87.
[2] 4 Philosophische Schriften, ed. Gerhardt, Bd. I, S. 16.
[3] 5 Johannes Colerus, Lebensbeschreibung Spinozas (1705), Kap. 11. Vgl. Spinoza – Lebensbeschreibungen und Dokumente, hrsg. von M. Walther, Hamburg 1998 (Phil. Bibl. 96 b), S. 93.