Ruim aandacht voor Spinoza in "Jüdisches Denken" – een levenswerk
Ook hierop werd ik geattendeerd door Ferdie Fluitsma. Deze informatie zal eerder van belang zijn voor bibliotheken die dit standaardwerk niet van hun planken verwijderd kunnen houden.
 Karl Erich Grözinger is sinds 2007 “Professor emeritus für
Religionswissenschaft und Jüdische Studien an der Universität Potsdam und war
Senior Professor am Zentrum Jüdische Studien Berlin- Brandenburg [Cf.]. Die drei schon vorliegenden Bände »Jüdisches Denken«
gelten als Standardwerke.” Aldus de uitgever.
Karl Erich Grözinger is sinds 2007 “Professor emeritus für
Religionswissenschaft und Jüdische Studien an der Universität Potsdam und war
Senior Professor am Zentrum Jüdische Studien Berlin- Brandenburg [Cf.]. Die drei schon vorliegenden Bände »Jüdisches Denken«
gelten als Standardwerke.” Aldus de uitgever.
Deze maand, op 15 oktober 2015, zal het vierde en laatste deel verschijnen van zijn grote project over het “Jüdisches Denken.” Buchpräsentation in Zentrum Jüdische Studien Berlin Brandenburg [Cf.].
Jüdisches Denken. Theologie - Philosophie - Mystik
Band 1: Vom Gott Abrahams zum Gott des Aristoteles. Campus, Frankfurt am Main 2004 [Cf.]
Band 2: Von der mittelalterlichen Kabbala zum Hasidismus. Campus, Frankfurt am Main 2005 [Cf.]
Band 3: Von der Religionskritik der Renaissance zu Orthodoxie und Reform im 19. Jahrhundert. Campus, Frankfurt am Main 2009 [Cf.]
Band 4: Zionismus und Schoah. Campus, Frankfurt am Main 2015 [Cf.]

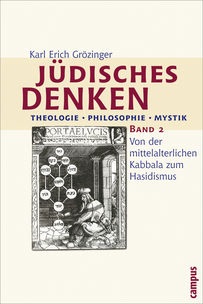

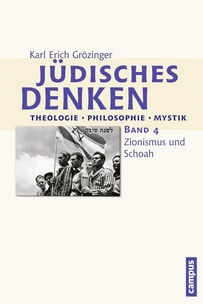
Een flink deel van het Derde Deel handelt over Spinoza. Het hoofdstuk over "Traditions- und Religionskritik" bespreekt achtereenvolgens:
Leone Modena di Venezia (1571 - 1648), p. 93 – 135
Uriel da Costa (Acosta) (1583/4 - 1640), p. 136 - 157
Baruch Bente Benedictus de Spinoza (1632 – 1677), pagina’s 158 – 229 – books.google brengt u direct naar p. 158
Wat zich via Google laat lezen, ervaar ik als een gedegen, goed leesbare en interessante tekst, Om daarvan een idee te geven, heb ik de volgende passage geselecteerd die ik overneem zonder de verwijzingen naar voetnoten [zie daarvoor p. 192: books.google].
5. Die Philosophie Spinozas
5.1 Grundlinien
Nach dem oben zur Position Spinozas im Rahmen des Jüdischen Denkens Gesagten und nach Aufgabenstellung dieses Bandes wird Spinoza hier vor allem vor dem Hintergrund des Jüdischen Denkens dargestellt, wohl wissend, dass für die meisten Philosophie-Historiker Spinoza vor allem einen Teil der »europäischen« Philosophiegeschichte bildete. Für Spinoza selbst waren jedoch die drei in Hebräisch, Latein und Arabisch geschriebenen philosophischen Literaturen eine gemeinsame Tradition, die letztlich auf der griechischen Philosophie aufruhte. Aber schon Harry Austryn Wolfson vertrat in seiner The Philosophy of Spinoza die These, dass für Spinoza »Hebrew sources appear as the matrix in which the general outline of ideas was formed.« Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und behaupten, dass die Philosophie Spinozas in weitem Maße geradezu als Auseinandersetzung mit seinen jüdisch-philosophischen Lehrmeistern verstanden werden kann, wofür ja der Theologisch-Politische-Traktat ein weiteres untrügliches Indiz ist. Diesen Eindruck bestätigt auch eine Lektüre des philosophischen Werkes Milchamot ha-Sehern (Kämpfe Gottes) von Levi Ben Gerson, einem hebräischen »Lehrbuch« der mittelalterlich arabischen und hebräischen Philosophie, das bis in die Formulierungen hinein die Themenstellungen Spinozas vorbereitet und in der Ethik wohl eigens zitiert wird.
Diese »hebräisch«-griechische Matrix des spinozanischen Denkens zeigt sich zuallererst in der zentralen Deutung des Intellekts, oder der Vernunft, die nicht nur als anthropologische Kategorie gilt, sondern auch bei Spinoza noch ontologischer Natur war, das heißt, dass sie zuallererst eine göttliche übermenschliche Kategorie war, an welcher der Mensch und in gewisser Weise alle in der Welt existierenden Dinge teilhatten. Ein Zweites war die grundlegende Problematik des Verhältnisses von Materie und Intellekt, mittelalterlich meist als Materie und Form behandelt. In diesem Zusammenhang spielt auch für Spinoza, wie für die mittelalterlichen Denker, der Mensch eine besondere Rolle, insofern er im eminenten Sinn als der Besitzer von beiden galt, also an ihm dieses Verhältnis zum Problem und zum Ansatzpunkt für Lösungsvorschläge wurde. Ein Letztes schließlich ist das gemeinsame Bemühen, die gesamte Existenz aus einer einzigen Ursache her zu verstehen und insofern das gesamte Seiende als eine Einheit zu erfassen.
Gerade am letzteren Punkt zeigen sich jedoch die grundlegenden Trennlinien, die nichts desto weniger als Zeugen der gemeinsamen Matrix erscheinen. Spinoza hat mit der für ein strikt kausales oder auch emanatistischen Denkens inkonsequenten Dualität von Intellekt und Materie gebrochen, welcher auch noch sein wichtigster »lateinischer« Lehrmeister Rend Descartes (1596-1650) verschrieben war, von dem Spinoza ansonsten vieles, bis hinein in die Terminologie, über-nommen hat. Damit hat Spinoza die von der mittelalterlichen Philosophie nur ausweichend und mit inkonsequenten Lösungen beantwortete Frage, wie aus einer rein intellektuellen ersten Ursache (Gott) schließlich die Materie verursacht werden konnte, da doch eine Ursache nur das bewirken kann, was in ihr selbst vorhanden ist, einer Entscheidung zugeführt. Die Platoniker sprachen in die-sem Zusammenhang vom Nachlassen der göttlichen Emanationskraft mit voranschreitender Entfernung von der Emanationsquelle, die dann zu einem Umschlag vom Intellektuellen zum Materiellen führte oder aber man versuchte es mit dem Brückenschlag zur biblischen Schöpfungslehre, indem man dem Schöpfer einen Willen zuschrieb, der ohne einer notwendigen Kausalität zu unterliegen in freier Entscheidung eine creatio ex nihilo zu einem von ihm gewollten Zeitpunkt hervorbringen konnte. Spinoza ließ sich auf keine derartige Kompromisse ein. Er wählte aus der hebräischen Philosophie alleine deren rationalistisch-kausalistische Tradition und verwarf die ihr widersprechende voluntaristisch-kreationistische biblisch-rabbinische Traditionslinie. Dies hatte zur Konsequenz, dass der Gott Spinozas, auch diese Redeweise ist ein Erbe der Vergangenheit, kein willentlich handelnder war, sondern einer der gemäß der Notwendigkeit seiner Natur wirkte, reine Ursache im streng kausalen Sinne ist. Die nächst weitere fast noch drastischere Konsequenz war die, dass dieser Gott nunmehr als die wahrhafte Ursache von allem Seienden gemäß dem Grundsatz, dass Ursache und Wirkung keine sich widersprechenden Kategorien haben können, nunmehr in seinem Wesen nicht nur den Intellekt, sondern auch die Materie repräsentieren müsse. Sie nannte er nach dem Vorgang von Descartes, die »Ausdehnung« (Extension), um sie von der konkret irdischen Materie zu unterscheiden, wozu unten noch Weiteres zu sagen sein wird. Immerhin kann darauf verwiesen werden, dass die ersten Schritte in dieser Richtung bereits von den jüdischen Neuplatonikem Jizchak Jisraeli, Pseudo-Empedokles und vor allem Schlomo Ibn Gevirol getan wurden, nach denen bereits die erste emanierte Substanz, der Intellekt, aus Materie und Form besteht, die ihrerseits im »Wesen« und »Willen« der Gottheit ihr Urbild haben. Außerdem glaubt Ibn Gevirol, dass der Träger der materiellen Kategorien selbst noch eine intelligible Substanz sei, wodurch die Distanz von Materie und Form, d.h. Geist, ein weiteres Mal verringert wurde.
Erhalten bleibt bei Spinoza die mittelalterliche Makro-Mikrokosmos-Struktur der Anthropologie, die auch als die Lehre von der »Gottebenbildlichkeit« des Menschen verstanden wurde. Der Mensch wird bei Spinoza nun wieder in ganzheitlicher Weise Ebenbild Gottes, das heißt als Einheit von Materie und Geist, und nicht nur als psychisches oder intellektuelles Wesen, wie dies die mittelalterlichen Denker sagen mussten, nachdem ihr Gott reiner Geist war. Ein weiteres Element dieser »Ebenbildlichkeit« des Menschen ist noch, dass er nun, wie die Gottheit selbst, aus der Notwendigkeit der Natur und nicht aufgrund eines freien Willens handelt.
Josef Ben-Schlomo weist darauf hin, dass Spinoza bei seiner Darstellung der Philosophie in der »Ethik« den archimedischen Punkt des Philosophierens ver-schoben habe. Während die mittelalterlichen Denker den Weg der Schlussfolgerungen von der Wirkungsvielfalt in der Welt bis zur prima causa gegangen seien und mithin den Maßstab des Begrenzten und Verursachten für des Unverursachte und Unbegrenzte gesetzt hätten, und auch Descartes das menschliche denkende Individuum (cogilo ergo sum — ich denke, also bin ich) zum Ausgangspunkt seines Philosophierens genommen habe, hätte Spinoza eine vollständige Umkehrung vollzogen. Spinoza habe nämlich die Reihenfolge umgekehrt und sei vom Absoluten, von der sich selbst verursachenden Ursache, das heißt von Gott aus, zu den Wirkungen vorangeschritten, weil letztere adäquat eben nur im Lichte dieser ersten Ursache zu verstehen sind. Dies ist zweifellos eine Aussage, die den Duktus des spinozanischen Hauptwerkes der Ethik trifft. Dennoch ist für die zentrale Argumentation der Einheit von Materie und Form auch für Spinoza die Beobachtung am Menschen ausschlaggebend, wie im Kapitel über das Menschenbild deutlich werden wird. Dieser anthropologische Akzent wird gleichfalls durch das Werk im ganzen bestätigt, insofern es, wie sein Titel anzeigt und die Quantitäten der Themen innerhalb des Werkes betätigen, vor allem um den Menschen und dessen Weg zur Glückseligkeit (beatitudo) kreist und die ontologische Theologie, welche im öffentlichen Bewusstsein viel stärker präsent ist, doch auch aus der Betrachtung des begrenzten und vertu-sachten Menschen gewonnen ist.
All diese Bezüge zur mittelalterlichen Tradition sind dem Leser zunächst durch Spinozas Darstellungsweise »more geometrico«, das heißt mit den von der euklidischen Geometrie übernommenen Argumentationsweise in Definitionen, Axiomen, Lehrsätzen und Anmerkungen verstellt, werden aber der weitergehen-den Reflexion deutlich. Ein letztes Indiz für diese Verbundenheit gerade mit der hebräisch-philosophischen Tradition ist, dass Spinoza, der in der Ethik seine Quellen fast nie bezeichnet, neben dem wohl nur zwei Mal genannten Descartes und den Stoikern, an prominenter Stelle einmal eigens »einige Hebräer« [2/7s] nennt, welchen er die Ehre gibt, die zentrale These Spinozas, nämlich die Vereinigung von »Denken« und »Ausdehnung« in der einen Substanz, sprich in der Gottheit, »gleichsam durch einen Nebel gesehen zu haben«. Stärker konnte die Filiation des eigenen Denkens aus der jüdischen Tradition in diesem Werk kaum ausgedrückt werden. [p. 192 – 195]
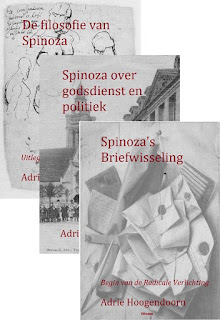

Reacties
Tekstdeel uit Band 3 ter illustratie toegevoegd
Stan Verdult 08-10-2015 @ 17:36