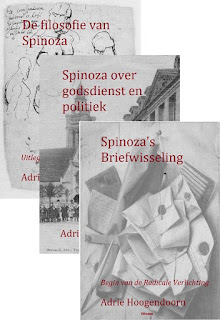Sigismund Eduard Loewenhardt (1796-1875) zet 'zijn Spinoza' af tegen die van anderen
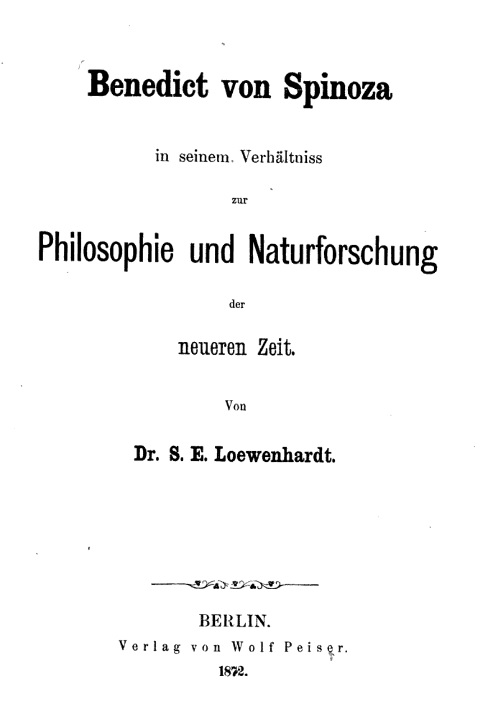 Zoals in het vorige blog over Loewenhardt aangekondigd, neem ik hier een
stukje over uit zijn boek Benedict von
Spinoza in seinem Verhaltniss zur Philosophie und Naturforschung der neueren
Zeit. W. Peiser, 1872. Hij zou het als zijn lievelingsboek beschouwd hebben
en heeft er, zoveel is wel duidelijk, zeer veel aandacht en tijd in
geïnvesteerd.
Zoals in het vorige blog over Loewenhardt aangekondigd, neem ik hier een
stukje over uit zijn boek Benedict von
Spinoza in seinem Verhaltniss zur Philosophie und Naturforschung der neueren
Zeit. W. Peiser, 1872. Hij zou het als zijn lievelingsboek beschouwd hebben
en heeft er, zoveel is wel duidelijk, zeer veel aandacht en tijd in
geïnvesteerd.
Nadat hij het in een eerste deel over Spinoza's 'Körperlehre', over kracht en stof, materialiteit en lichamen, heeft gehad zet hij vervolgens systematisch Spinoza's leer uiteen: I, over het systeem van Spinoza (substantie/God en modi), II over Spinoza's 'Seelenlehre' (bewustzijn, zelfbewustzijn, onsterfelijkheid en eeuwigheid, de kensoorten, de vrije wil) en III over de oorsprong en de natuur der ‘Seelenbewegungen'.
Volgt een tweede deel: “Nachweis der Uebereinstimmung und Abweichung des System Spinoza's über die Seelenthätigkeit mit den Ergebnissen der neuem, durch physiologische Forschungen unterstützte, Seelenlehre - Erfahrungsseelenlehre.”
En tenslotte een derde deel: “Widerlegung der von einigen Schriftstellern gegen das System Spinoza's erhobenen Haupteinwendungen.” Hij gaat uitgebreid in op Kuno Fischer, op Jacobi, Hegel en vele anderen. Ik neem hierna een deel van zijn commentaar op Fischer. Het geeft een indruk van zijn kennis en behandeling.
Dritte Abtheilung.
Widerlegung der von einigen Schriftstellern
gegen das System Spinoza's erhobenen
Haupteinwendungen
Niemand wird es wohl nach dem Voraufgestellten auffällig finden wenn wir unseren Lesern die Lehren Spinoza's in einer ansprechenden und leicht fasslichen Form empfehlen möchten da wir aber hierzu kein brauchbareres Werk als den I Band der Geschichte der neuem Philosophie von Kuno Fischer Heidelberg 1865 gefunden haben so liegt es uns auch ob auf die darin aufgestellten Irrthümer aufmerksam zu machen die indess gegen die Vorzüge deren die Ausführung jenes Lehrgebäudes sich erfreut dennoch verschwinden dürften.
Im Allgemeinen kann man wohl sagen dass die Widersprüche welche gegen das System Spinoza's zu allen Zeiten erhoben worden sind theils aus Missverständnissen theils aus bestimmten Tendenzen hervorgegangen sind. Wenn es nun aber wahr ist was die Meisten behaupten dass das System Spinoza's in seiner Folgerichtigkeit unangreifbar ist so müssen gewisse Principien von denen es ausgeht falsch sein. Sind die Principien oder Axiome die er an der Spitze seiner Sätze stellt und aus denen er folgert richtig und unantastbar so müssten die Folgerungen falsch gezogen sein. Ist aber - wie es sich bei diesem klaren Denker kaum anders erwarten lässt - keine von beiden der Fall so bleibt nur übrig dass man gewissen Voraussetzungen zu Liebe gewisser anderer Tendenzen halber ihn bekämpft. So greift man bald den Begriff der Freiheit heraus und behauptet dass, da er die Freiheit zu leugnen scheine, sein ganzes System unhaltbar sei bald den Begriff des Zwecks und sucht zu zeigen wie unerträglich eine Philosophie sei die den Zweckbegriff verwerfe; bald sucht man ihn dadurch zu beseitigen, dass man sein System als Pantheismus, Materialismus, Akomismus, Naturalismus, Rationalismus, Dogmatismus und Atheismus bezeichnet. Das Wunderbarste dabei ist dass dies von solchen Philosophen geschieht, die zuerst ganz in Bewunderung der Grösse und Klärbeit seines Denkens aufgegangen zu sein scheinen.
Nachdem Kuno Fischer das System Spinoza's, in seiner Eigenthümlichkeit in aller Bündigkeit dargestellt und die fehlerhafte Auffassung eines Theils seiner Vorgänger: als Bayle's, Kant's, Haman's, Jacobi's, Feuerbach's, Fichte's, Mendelssohn's, Trendelenburg's und selbst Erdmann's, die er “Gegner ohne gründliche Kenner” zu sein, nennt, treffend nachgewiesen, gelangt er S. 545 der erwähnten Schrift zur nähern Charakteristik und Kritik des Systems. Hier fügt er nun den Eingangs erwähnten Worten Fr. H. Jacobi’s hinzu: “Denn in der That, Spinoza ist einer der klarsten Köpfe, die es je gegeben, und wem in dieser Klarheit das Lehrgebäude Spinoza s nicht bis in seine einzelne Theilen hinein einleuchtet, der hat es entweder aus einem falschen Gesichtspunkte oder mit einem eingenommenen und getrübten Blicke betrachtet. Ich rede von der Klarheit, mit welcher das System in dem Geiste Spinoza's selbst gegenwärtig war.” Wenn nach diesem Ausspruch innere Widersprüche im Systeme an sich schon zu den Undenkbarkeiten gehören. Kuno Fischer aber, ausser dem aus einem Missverständnisse hervorgegangenen Tadel in der Charakteristik, noch sieben Widersprüche darin rügen zu können vermeint, so darf man nur die falschen Quellen dieser wie jener nachweisen, um das System von jedem Flecken zu reinigen. Dieses in allen Punkten darzuthun, wollen wir anderswo unternehmen, hier jedoch des beengten Raumes wegen nur einige dieser vermeintlichen Widersprüche bloslegen.
Kuno Fischer erklärt, dass die Philosophie Spinoza's die wahre sein würde, wenn sie nicht an gewissen Widersprüchen litte, die theils in ihrer Eigenthümlichkeit, theils in ihrem allgemeinen Charakter liegen.
Zuerst also bezeichnet er “als allgemeinen Charakter der Lehre Spinoza's den vollkommenen Rationalismus, der eine klare und deutliche Erkenntniss des Zusammenhanges aller Dinge geben wolle und dadurch den Gegensatz bilde zum Skepticismus, der aus Gründen der Vernunft die Möglichkeit rationeller Erkenntniss bestreitet; ferner zum Kriticismus der die Möglichkeit der Erkenntniss auf ein bestimmtes Gebiet beschränkt, und endlich zum Mysticismus der eine Erkenntniss aus innerer Offenbarung behauptet.”
Hiergegen ist einzuwenden, dass Spinoza in seiner Philosophie nicht beabsichtigt, eine Erkenntniss aller Dinge zu geben, söndern lediglich zu zeigen sich bemüht, wie die Dinge in ihrer Nothwendigkeit begriffen werden müssen und worin das Wesen der adaequaten Erkenntniss im Gegensatz zur inadaequaten bestehe. In Epist. 60 sagt er “ich behaupte nicht Gott durchaus zu erkennen, sondern einige Attribute, die Unkenntniss vieler Attribute hindert nicht, einige zu erkennen, sowie man erkennen kann, dass die drei Winkel eines Dreiecks gleich sind zweien rechten ohne desshalb alle Eigenschaften eines Dreiecks zu er kennen.” Wenn Spinoza ferner in der adaequaten Erkenntniss die rationelle von der intuitiven Erkenntnissart unterscheidet so ist einleuchtend, dass die von Kuno Fischer gegebene allgemeine Charakterisirung seines Systems als vollendeter Rationalismus verfehlt ist. Die unmittelbare Erkenntniss, welche Spinoza von der vermittelten oder rationellen unterscheidet, gehört ebensowohl wie die inadaequate dem Attribute des Denkens an, und daher ist dieses Denken im Sinne Spinoza's nicht dem Rationalismus gleichzustellen.
Eben so verhält es sich mit dem Vorwurfe des Pantheismus. Duldet ein vollkommener Rationalismus nichts Unerkennbares in der Natur der Dinge, behauptet er die ewige Ordnung der Dinge in ihrem letzten Grunde zu erkennen; “so wird die ewige Ordnung der Dinge gleich Gott gesetzt und der Pantheismus ist vorhanden.”
Dies ist einer jener Einwürfe, die aus der bewussten oder unbewussten Tendenz hervorgehen, sich selbst gegen den Vorwurf pantheistischer Denkungsweise zu wahren. Allerdings negirt Spinoza den Dualismus denn er erklärt Gott für die immanente, nicht für die transiente Ursache des Weltalls. Aber eben so stark, obgleich nicht ausdrücklich, erklärt er sich gegen den Pantheismus. Die Immanenz schliesst nämlich den Unterschied nicht aus. Wenn Spinoza sagt: Substantia sive Deus, so meint er damit nicht, dass die Ordnung der Dinge gleich Gott sei, sondern dass das Wesen, das Ursache seiner selbst ist, ihm Gott ist, und in ihm müssen die Dinge, von deren Dasein und Wesen er die Ursache ist, eben desshalb erkannt werden. Was nun so bestimmt unterschieden wird, von dem kann man nicht sagen, dass es gleichgesetzt werde.
“Aber, sagt K Fischer” Spinoza begreift die ewige Ordnung der Dinge als eine nothwendige Folge aus dem Wesen Gottes, und zwar nicht als Schöpfung, sondern als Natur; er sagt daher: Substantia sive natura. Sein System ist also Naturalismus.” Zur näheren Erklärung fügt Fischer hinzu: “darunter ist zu verstehen, dass er die Natur nicht aus dem Geiste, sondern den Geist aus der Natur erklärt und ableitet; denn nicht der Grund der Erkenntniss, sondern der Grund der Dinge ist sein Princip: er geht nicht vom Principium cognoscendi, sondern vom Principium essendi aus. Die Substanz nämlich, durch welche alle Dinge sind, d.h die Macht, die vollkommen unabhängig von unserer Erkenntniss und zugleich vollkommen erk.ennbar ist, also von der wir abhängig sind, die aber Zügleich unser Object ist, die ist sein Princip. Diese Macht aber ist Natur. In diesem Naturalismus muss nothwendig das unbestimmte Selbstbewusstsein, Persönlichkeit und Freiheit geleugnet werden.“
Schon zu Spinoza's Zeit ist man ihm mit diesem Einwurfe gekommen. Er sagt Epist. 20: “dass Manche behaupten, ich stelle auf, dass Gott und Natur dasselbe sei, darin irren sie; sie verstehen unter Natur eine körperliche Materie.” Wohl gebraucht Spinoza einige Male den Ausdruck: Deus sive natura. Wenn man aber bedenkt, dass er natura naturans und naturata, als Wirkung und Folge unterscheidet, und dass er unter jener dasjenige versteht, was in sich ist und aus sich begriffen wird, also die Attribute, welche ewiges und unendliches Wesen ausdrücken, d.h. das Wesen Gottes, insofern er vom Verstande erkannt wird, und insofern er freie Ursache ist; so fällt der Einwurf in sich selbst zusammen, dass er die Natur nicht aus dem Geiste erkläre. Ferner ist es falsch, dass er den Geist aus der Natur erkläre. Allerdings geht Spinoza nicht im Sinn des Kriticismus vom Principium cognoscendi aus, sondern zugleich vom Principium essendi. Denn Gott wird erkannt als ausgedehntes und denkendes Wesen, und von dieser Erkenntniss aus stieg er zur Natur und den darin enthaltenen Dingen herab,. Wie weit ist Spinoza also über die Einseitigkeit des Idealismus und Materialismus erhaben! Von dem Vorwurfe, dass er Selbstbewusstsein, Persönlichkeit und Freiheit leugne ist bereits gesprochen.
Ausserdem aber widerlegt sich dieser Einwand durch die Attribute der Substanz selbst: da Gott, wie erwähnt, keinen Begriff, nicht einmal den seiner Attribute, also auch nicht den des Denkens voraussetzt, so kann die Substanz auch nicht Object des Denkens, wie die Natur, sein, welche eine Modification der Substanz ist und derselben mithin vorangeht. Interessant ist, dass K. Fischer nach seinen Untersuchungen über das Verhältniss zwischen Gott und Welt im Sinne Spinoza's zu dem Ergebniss gelangt: “Gott verhalte sich zur Welt, wie die wirkende Natur zur bewirkten. Es gäbe nur eine Art, dieses Verhältniss im Geiste Spinoza s richtig zu fassen: die wirkende Natur ist die ewige Ursache, die bewirkte die ewige Folge; der Unterschied zwischen Ursache und Wirkung ist der Unterschied zwischen Gott und Welt, und es giebt in der Lehre Spinoza's keine andere Einheit und keinen andern Unterschied beider (l.c. 327)” So wichtig dies an sich ist, so falsch ist der von K.F. daraus gezogene Schluss, “dass dadurch auch die Einheit zwischen Gott und Welt in jeder andern Beziehung dargethan wäre”, denn es ist von Spinoza bereits auf den sehr wesentlichen Unterschied hingewiesen, dass Gott unendliche Attribute hat, obgleich der menschliche Verstand nur zwei zu unterscheiden vermag, dass die bewirkten Dinge, die Welt aber in der That nur auf Denken und Ausdehnung beschränkt und jedes Ding wieder in endloser Weise aus der göttlichen Modification erfolgt sei!