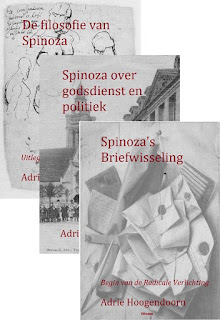Barbara Polovtsova (1877 - 1936) De eerste Russische filosofe en Spinoziste
Ook: Warwara Nikolajewna Polowzowa (volgens Maidanski); of Varvara. N. Polovcova, of Polovszova (volgens de Duitse Spinoza Bibliografie]
Al enige malen had ik een blog over Russische filosofen die – soms sterke - belangstelling voor Spinoza hadden. Aan het eind van dit blog zal ik de links erheen geven. Barbara was ik nog niet eerder tegengekomen.
Op Polovtsova/Polowzowa kwam ik toen ik bezig was met Stanislaus Dunin-Borkowski (zie hier en hier]. Zij bleek van diens Der junge Spinoza een diepgaande studie te hebben gemaakt. A.D. Maidanski heeft in zijn „Russische Spinozisten des 20. Jahrhunderts” een uitgebreide en informatieve paragraaf over deze eerste Russische filosofe en Spinoziste. Ik vond interessant te lezen, hoe zij een van de weinige critici van Duni-Borkowski was en vooral hoeveel studie van Spinoza’s werk zij maakte. Interessant hoe volgens haar emendatio met ‘zuivering’ i.p.v. ‘verbetering’van het verstand zou moeten worden vertaald, namelijk zuivering van daarin opgeslagen vooroordelen. Ik vind wat Maidanski ervan weergeeft redelijk overtuigend en ben benieuwd of zij in haar stuk ook argumenten gaf waarom Spinoza dan niet ‘purificatio’ zou hebben gebruikt.
Graag neem ik die uitvoerige paragraaf over haar hierna over (ze omvat ca 5 A4-tjes). De voetnoten brengen u direct naar het stuk zelf… Ik vul de gegevens aan die ik met behulp van de Google-vertaalmodule aantrof op een site met deze uitvoerige Biografie van Barbara Polovtsova.
Ze werd geboren in een adellijke Moskouse familie Simanovsky. Huwde in maart 1898 met de vijftien jaar oudere Valeriaan Viktorovitsj Polovtsov, bioloog, waarna ze Polovtsova ging heten. Ze werkte met hem samen aan de vertaling van een boek van Lamarck. Toen zal al ongeveer 25 jaar oud was ging ze in Duitsland natuurwetenschappen studeren. [Hierna verder uit het essay van Maidanski]
Während die Namen und Arbeiten von Wygotski und Iljenkow jedem Philosophen und Psychologen, der in Rußland studiert hat, bekannt sind, sind die Werke der ersten russischen Philosophin und Spinozistin, Warwara Nikolajewna Polowzowa, in unserer Zeit sogar den Spinoza-Forschern praktisch unbekannt. Aus diesem [136] Grunde ist es zweckmäßig, zuallererst einige biographische Angaben über Polowzowa zu machen. Warwara Nikolajewna Polowzowa wurde in einer adeligen Familie in Moskau im Jahre 1877 geboren – zweihundert Jahre nach dem Tode von Spinoza. Nach der Absolvierung des Frauengymnasiums in St. Petersburg begann Polowzowa ihr Studium in Deutschland an der philosophischen Fakultät der Heidelberger Universität. Nach drei Semestern ging sie an die Universität Tübingen, studierte dort noch ein Semester und siedelte nach Bonn über. An der Rheinischen Universität vollendete sie ihre Ausbildung und verteidigte im Dezember 1908 ihre Dissertation zu einem für die philosophische Fakultät recht ungewöhnlichen Thema: „Untersuchungen auf dem Gebiete der Reizerscheinungen bei den Pflanzen“. Zu den Fachdisziplinen, in denen Polowzowa ihre Magisterprüfungen mit „summa cum laude“ ablegte, gehörten neben Philosophie auch Botanik und Zoologie. Ihre Dissertation wurde mit dem höchsten Prädikat „eximium“ bewertet, ein Teil dieser Arbeit wurde 1909 in Jena veröffentlicht. Während des Krieges ging das Original der Dissertation bei der Zerstörung der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität verloren. 5
1909 begann Polowzowa in der ältesten russischen philosophischen Zeitschrift „Woprosy filosofii i psichologii“ zu publizieren. 6 Redakteur der Zeitschrift war damals Lew Michailowitsch Lopatin, ein angesehener Leibniz-Forscher, der sich viel mit der Lehre von Spinoza beschäftigte und sie als dogmatischen Panlogismus und Fatalismus deutete. Es ist immerhin bemerkenswert, daß Polowzowa 1913 zum Ordentlichen Mitglied der Moskauer Psychologischen Gesellschaft gewählt wurde, auf der Grundlage einer Referenz von Lopatin. An den Sitzungen der Gesellschaft nahm Polowzowa jedoch nicht teil.
Die einen negierten Spinoza wegen dessen Gleichstellung von Gott und Natur, die anderen (Schopenhauer folgend) wegen Rückführung aller realen Verhältnisse auf die logischen (gemeint sind die Thesen des Theorems 7 des zweiten Teils der Ethik und der für Spinoza typischen Ausdruck ratio sive causa), wieder andere wegen seines Fatalismus bzw. seiner für die Philosophie untauglichen geometrischen Methode usw. usf.
Nicht minder charakteristisch waren auch Beschuldigungen Spinozas, er habe seine Ideen bei Aristoteles, bei den Stoikern, den Scholastikern, bei Bruno und bei Descartes entlehnt. Danach wäre die Philosophie von Spinoza eine seltsame Anhäufung fremder Meinungen. Dies ist besonders seltsam, wenn man sich daran erinnert, mit welcher Geringschätzung Spinoza sich über die „Aufnahme vom Hörensagen“ in seiner Abhandlung über die Läuterung des Verstandes geäußert hat. Mit zwei kritischen Stellungnahmen zu einem Werk des Klassikers dieser Interpretation, des Jesuiten Stanislaus von Dunin-Borkowski, begann Polowzowa ihre Laufbahn in der Spinoza‑Forschung. 11
Drei Jahre später erschien ihre große Abhandlung „Zur Methodologie der Erforschung der Philosophie von Spinoza“. Der wichtigste Teil dieser Arbeit gilt der Präzisierung „einiger Voraussetzungen, ohne die die Lehre von Spinoza weder im allgemeinen noch im besonderen verstanden werden kann“. 13 Das Buch enthält spezielle Abschnitte über den Begriff des Attributs und über die Relation zwischen Geist und Leib mit Bezug auf das Theorem 7 des zweiten Teils der Ethik.
Um den Sinn der lateinischen Terminologie zu klären, stützte sich Polowzowa auf die Abhandlungen über die Logik von Jacob Zabarella 15, die „Logik von Port Royal“ sowie auf die Angaben von philosophischen Lexika des 17. Jahrhunderts und auf die klassische Studie von Jacob Freudenthal „Spinoza und die Scholastik“. 16 Ganz besonders betonte Polowzowa die Notwendigkeit eines Studiums der Werke von Descartes, bei dem „wir die echten Grundlagen für die Klärung der meisten Ideen und Ausdrücke von Spinoza finden“. 17
Wenn die Philosophiehistoriker über die „geometrische Methode“ von Spinoza sprachen, so ignorierten sie offenkundig die Tatsache, daß Spinoza (und gleichermaßen Descartes) diesen Ausdruck nie gebrauchten. In seiner Abhandlung über die Läuterung des Verstandes und in seinen Briefen, in denen Spinoza den Begriff „methodus“ untersuchte, erwähnte er absolut keine Methode bzw. „Ordnung“ (mos, ordo) des geometrischen Beweises. Die verbreitete Verwechslung dieser Begriffe führte dazu, daß die echte Methode der Erkenntnis, die Spinoza verwand hatte, der Aufmerksamkeit der Forscher schlicht entging. 19
Polowzowa war davon überzeugt, daß fast alle Widersprüche, die Spinoza zugeschrieben wurden, sowie seine sogenannten „Entlehnungen“ bei anderen Philosophen dadurch verursacht waren, daß „Spinozas Versprecher bezüglich des Gebrauchs allgemein üblicher Termini in einem anderen Sinn außer acht gelassen werden“. Deshalb erwiesen sich diese Entlehnungen „bei näherer Betrachtung lediglich als verbales Zusammenfallen“. 22 [140]
Angesichts dessen, daß die Erkenntnistheorie Spinozas von Polowzowa als Fundament all seiner philosophischen Anschauungen betrachtet wurde, war ihr nächster Schritt – die Übersetzung von Spinozas Werk Tractatus de intellectus emendatione – völlig logisch. Dieser Traktat stellt eine Einführung in die Erkenntnistheorie von Spinoza und in seine Philosophie insgesamt dar – zugleich ist es auch eine Einführung in das Leben, die für die Philosophie unerläßlich ist. 25
Übrigens kann man feststellen, daß diese Tradition der Übersetzung der Abhandlung über die Läuterung des Verstandes in den englischen Übersetzungen von William Hale White und Amelia Hutchinson Stirling eingehalten wurde, die für Polowzowa nicht nur die besten, sondern auch die adäquatesten Übersetzungen der Texte von Spinoza zu jener Zeit waren. Gestützt auf diese Traditionen, bemühte sich Polowzowa darum, von der Terminologie des Originales minimal abzuweichen, wobei sie in die russische Übersetzung eine Reihe von Latinismen – „Imaginazia“, „Razio“, „Perzepzia“, „Ideat“, „Konzept“ und andere einführte und in Klammern und Anmerkungen praktisch alle charakteristischen lateinischen Ausdrücke Spinozas anführte.
An dieser Übersetzung arbeitete Polowzowa in Bonn im Jahre 1913. In ihrem Vorwort und ihrem Artikel über die Methodologie des Studiums der Philosophie von Spinoza erwähnte sie mehrmals eine von ihr geplante „Spezialforschung“, in der sie ihr Verständnis der Lehre Spinozas „detailliert begründen und entwickeln“ wollte. Man kann annehmen, daß das Buch im Jahre 1913 schon fast oder sogar schon ganz druckfertig war. „Die Übersetzung der Abhandlung über die Läuterung des Verstandes, die ich vorgenommen habe“, schrieb sie, „ist ein Ergebnis meiner speziellen Erforschung der Philosophie von Spinoza. Die Hauptergebnisse dieser Erforschung sollen gesondert veröffentlicht werden.“ 29
All diese Projekte wurden aber nicht verwirklicht – jedenfalls wurden sie nicht veröffentlicht. Mir ist unbekannt, was mit Polowzowa nach 1914 geschehen ist. [142] Man kann nur vermuten, daß der Beginn des Weltkrieges sie in Bonn mitten bei der Verwirklichung ihrer Projekte traf, und der Umstand, daß keine ihrer Arbeiten über Spinoza danach veröffentlicht wurde, legt den Schluß nahe, daß ihr weiteres Schicksal sehr traurig war.
Die Werke von Polowzowa fanden auch bei Philosophen Anerkennung, die vom Spinozismus weit entfernt standen. Boris Walentinowitsch Jakowenko, ein bekannter „transzendentaler Skeptiker“, setzte den Artikel von Polowzowa über die Methodologie der Erforschung der Philosophie Spinozas unter den drei bis vier „hervorragenden Arbeiten zur Geschichte der Philosophie“, die von russischen Autoren stammen und „die man nicht verschweigen darf“, an die erste Stelle. 32 Seit der Mitte der 30er Jahre wurde jedoch der Name Polowzowa in der Spinoza-Forschung fast nie mehr erwähnt. Das letzte Mal wurden die Ansichten von Polowzowa zur Philosophie Spinozas kurz von George Kline dargelegt. 33
Russische Spinozisten des 20. Jahrhunderts. In: Werner Röhr (Hrsg): Spinoza im Osten. Systematische und rezeptionsgeschichtliche Studien. Berlin: Edition Organon, 2005, SS. 135-154 - caute.tk
van A.D. Maidanski
* * *
Uit de bovenvermelde website met haar biografie, haal ik nog het volgende:
In Petrograd werkte ze in 1918 mee aan een tijdschrift; ze leefde niet meer samen met haar man, wijzigde haar naam wellicht daarom in Polovtseva. Toen haar man in november 1918 overleed was ze al niet meer in Rusland, maar werkzaam in Londen. Na de Revolutie werd ze secretaris in Londen van een samenwerking van Russische coöperatieve organisaties aldaar. In 1923 diende Polovtseva als vertegenwoordiger van het Russische Rode Kruis in het Verenigd Koninkrijk; vanaf 1925 was zij werkzaam bij diverse Internationale organisaties, b.v. voor een Vereniging voor Culturele Betrekkingen met het buitenland.
Toen ze op 29 december 1936 aan een hersenbloeding overleed woonde ze in Brentford, gelegen aan de noordelijke oever van de Thames in het graafschap Middlesex.
* * *
Blogs over Russen
Moskouse interesse in Spinoza bij zijn 250e sterfdag in 1927
Evald Vasilyevitch Ilyenkov (1924 - 1979)
Zie ook:
Igor Kaufman, "Studies on Spinoza in Russia" [PDF]. Heeft ook veel over Polovtseva