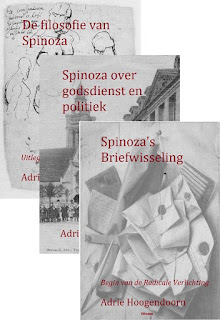Nog eens iets van Wolfgang Bartuschat
In november vorig jaar had ik enige blogs over Wolfgang Bartuschat; ik vermeld ze hieronder. Sindsdien ben ik een paar maal begonnen aan zijn Spinozas Theorie des Menschen (1992), maar dat lees je niet eenvoudig even voor de vuist weg. En daar er niet een of andere verplichting achter zit, loopt zo’n moeilijk boek het risico voor iets anders weggelegd te worden. Ik weet dat ik hier niet de enige in ben. Als je het dan weer oppakt moet je vanvoorafaan beginnen – met hetzelfde risico. Dit is mij nu enige malen overkomen. Maar, wie weet..., ooit…Intussen valt op dit blog regelmatig Bartuschat’s naam, recent nog. Dat deed mij besluiten om een tekst van hem, waarin hij in kort bestek enige hoofdlijnen van zijn wijze van lezen van Spinoza geeft - een flink deel van het volgende hoofdstuk van hem:
Wolfgang Bartuschat, “Subjekt und Metaphysik in Spinozas Ontologie.” In Jürgen Stolzenberg (Hrsg), Subjekt und Metaphysik: Konrad Cramer Zu Ehren, Aus Anlass Seines 65. Geburtstages. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2001, p 15-28
Daar een deel van deze tekst in books.google te lezen is, neem ik aan dat ik hem hier ook wel mag overnemen. Het gaat om ongeveer het aaneensluitende laatste kwart (vanaf p. 25).
In die bijdrage vatte hij nog eens puntsgewijs samen hetgeen hij ook al in zijn grote bovengenoemde Spinoza-monografie had betoogd, n.l. dat Spinoza's filosofie vanuit een dubbelperspectief opgebouwd is en zo dus ook gelezen moet worden. Het ene perspectief wordt ontwikkeld in het eerste deel van de Ethica ("De Deo") die als "basis-ontologie" (p.23) of als "struktuurmetafysica" (p. 18) te zien is. Het andere perspectief neemt Spinoza in de delen II t/m V in, waarin hij over de mensen en in het bijzonder over de menselijke geest, de mens humana, handelt. Terwijl in het eerste deel uit definities en axioma's op zuiver formele wijze een structuur ontworpen wordt, komt de invulling van dat geraamte, de concretisering ervan derhalve, aan de orde via de empirische fundering van de menselijke geest. Bartuschat stelt voor niet bij De Deo op te houden (wat volgens hem de idealisten deden), maar de Ethica a.h.w. van achter naar voren te lezen. Volgens Bartuschat impliceert Spinoza's “Theorie over de mens” zijn “Theorie over het Absolute.” De theorie over de menselijke subjectiviteit stemt harmonisch overeen met de structuurmetafysica van het eerste deel. Ik begin waar hij commentaar geeft op het pantheïsme dat in Spinoza gelezen wordt.
[…]
Ein solcher Pantheismus, der, so sieht es aus, nicht nur die Welt vergöttert, sondern auch alles Einzelne in ihr, impliziert natürlich keine Identität, nicht einmal eine Identität von Gott und Welt und schon gar nicht eine solche von Gott und Einzelnem in der Welt. Er enthält nur so viel, daß in jedem Einzelnen ein göttliches Moment ist, also etwas Essentielles, eine Essenz, die Spinoza bekanntlich als eine modifizierte potentia Dei bestimmt, der das Merkmal Gottes, Ursache von Wirkungen zu sein, wesentlich zukommt (Eth. 1, Lehrsatz 36). Bei einem endlichen Ding, wie es der Mensch ist, ist diese Essenz eingelassen in ein konkretes Existieren, das nicht aus ihr folgt und das die Wirkungen, die der Mensch hervorzubringen vermag, nicht Folgen allein der eigenen Essenz sein läßt (Eth. IV, Lehrsatz 4). Darin ist der Mensch wie jedes endliche Ding abhängig von den empirischen Umständen der Welt, innerhalb derer ein Ding in zeitlicher Erstreckung existiert und gegen die es sich selbst zu erhalten strebt, welches Streben (conatus) das Sein eines endlichen Modus als eines konkreten Dinges ausmacht (Eth. III, Lehrsatz 7). Daß ein solches Ding in der Differenz zu Gott ein Modus ist und damit ein von Gott Hervorgebrachtes, läßt sich folglich von dem Ding selbst her nur dann erweisen, wenn gezeigt wird, wie es unter den konkreten Bedingungen seines Existierens sich als ein Modus begreifen kann. Dem dienen die Teile II-V der Ethica, die den menschlichen Geist zum Thema haben. Der an ihm zu erbringende Nachweis muß unter zwei Erfordernissen stehen: Die Ursache des menschlichen Geistes muß zum einen schon in ihm sein, so daß er sie nur in sich aufzudecken hat, die er als Ursache eines Endlichen zum anderen jedoch nur aufdecken kann, wenn er sie unter den Bedingungen der eigenen Endlichkeit aufzudecken vermag.
Daß diese Überlegung Spinoza leitet, sei kurz aufgezeigt. Der 2. Teil der Ethica, der eine Theorie des Erkennens entwickelt, handelt von dem konkret existierenden menschlichen Geist, dessen Ideen konkret existierende Dinge zum Gegenstand haben, des näheren den eigenen Körper und über ihn auch äußere Körper (Eth. II. Lehrsatz 11ff.). Aus diesem Tatbestand leitet Spinoza als erstes die defiziente Erkenntnisform der imaginatio als die dem Menschen von Natur aus zukommende Erkenntnisart ab (Eth. II, Lehrsatz 17-29). Nach den Darlegungen zur inadäquaten Erkenntnis und nach Erwägungen darüber, wie unter diesen Bedingungen adäquate Erkenntnis möglich ist (Eth. II, Lehr-satz 30-44), verweist er am Ende auf die scientia intuitiva als die höchste Erkenntnisart (Eth. II, Lehrsatz 45-47). In ihr ist das menschliche Erkennen, so wird Spinoza dann im 5. Teil ausführen (Eth. V, Lehrsatz 21ff.), nicht, wie in der imaginatio, ein abbildendes Repräsentieren körperlicher Ereignisse, sondern hat Gott zum Gegenstand und zwar, im Unterschied zur rationalen Erkenntnisart, als Ursache eines Einzelnen, nämlich dessen, der in dieser Weise erkennt, so daß in ihr der Mensch Gottes und seiner selbst in eins gewiß ist (Eth. V, Lehrsatz 31, Scholium). In Spinozas Augen ist das keine geheimnisvolle und exklusive Erkenntnisart, die irgendetwas mit einer Mystik zu tun hätte, in der sich Gott und Mensch vereinigten. Das wird daraus deutlich, daß er die Möglichkeit intuitiven Erkennens ausdrücklich an die im 2. Teil entwikkelte Erkenntnisart der imaginatio bindet, der alle Menschen in ihrer Zeitlichkeit und Körperlichkeit unterliegen.
Ohne viel Aufwand sagt Spinoza in Lehrsatz 45 des 2. Teils: Jede Idee eines beliebigen wirklich existierenden Körpers oder Einzeldinges schließt notwendigerweise Gottes ewige und unendliche Essenz in sich ein („involvit"), um daraus in Lehrsatz 47 zu schließen, daß der menschliche Geist eine adäquate Erkenntnis von Gottes ewiger und unendlicher Essenz hat („habet"). Jede Idee, welche auch immer und gerade auch die inadäquate eines existierenden Körpers, schließt die Essenz Gottes in sich und zwar, wie der Beweis zu Lehrsatz 45 ausdrücklich macht, weil Gottes Essenz die Ursache dieser Idee ist und insofern in ihr präsent ist. Deshalb haben wir, sofern wir nur eine Idee haben, welche auch immer, ebendamit die Erkenntnis Gottes in dessen Essentialität und nicht nur auf der Basis irgendwelcher Vorstellungen, die wir uns von ihm machen. Mit jedem Erkennen, wie geartet dies auch sein mag, ist sie schon mitgegeben, weil anders wir überhaupt nicht erkennen könnten; denn allein dies, daß wir uns im Erkennen auf von Ideen verschiedene Körper beziehen, hat die Essenz Gottes zur ontologischen Voraussetzung.11 Bei allem Erkennen ist immer schon ein Prinzip in uns wirksam, das nicht selbst Erkennen ist, um das wir auch nicht wissen müssen, um überhaupt erkennen zu können, das aber zum Gegenstand unserer Erkenntnis gemacht werden kann.
Gott, der allem Erkennen zugrunde liegt, zum Gegenstand der Erkenntnis zu machen, bedarf freilich eines besonderen Aktes, der es erst erlaubt zu sagen, daß wir seine Erkenntnis in einem strengen Sinne „haben". Das notorisch vieldeutige lateinische ‘habere’ ist bei der ersten Einführung des Begriffs der scientia intuitiva in einem schwachen Sinne gebraucht, was auch das Scholium zu Lehrsatz 47 verdeutlicht, in dem es heißt, daß aus den Erwägungen zur Ontologie ersichtlich sei, daß die unendliche Essenz Gottes allen bekannt sei (notus), daß diese Kenntnis aber noch nicht eigentlich Erkenntnis ist. In unserem Erkennen immer schon enthalten, ist die Essenz Gottes doch nicht schon etwas für uns in dem Sinne, daß wir um sie wüßten. Was Spinoza darlegt, ist allein dies, daß die Möglichkeit eines solchen Wissens nicht abwegig ist, sondern im Gegenteil höchst plausibel, weil sie die Folge des In-Seins Gottes in allen Dingen und damit auch in allen Ideen ist.
Die Wirklichkeit der intuitiven Erkenntnis als etwas, das das menschliche Subjekt realisiert und von dem her es sich im Ganzen seiner Weltorientierung, zu verstehen vermag, wird erst am Ende der Ethica dargetan. Und dazwischen liegt sehr viel, nämlich eine weit ausgebreitete Affektenlehre, in der Spinoza mehrere Formen menschlichen Sichverstehens entwickelt, die voneinander verschieden und zugleich aufeinander bezogen sind.12 Warum Spinoza von der Darlegung der ontologischen Basis der intuitiven Erkenntnis am Ende des 2. Teils nicht direkt zur Darstellung dessen, wie sich diese Erkenntnisform in der Perspektive des erkennenden Subjekts zeigt, übergeht, das liegt daran, daß die Gründe zu entwickeln sind, die den Menschen daran hindern, zum Bewußtsein dessen, was ihn immer schon bestimmt, zu gelangen und sich selbst von ihm her zu verstehen. Solche Hinderungsgründe haben nichts, wie Descartes noch wollte, mit subjektiver Disziplinlosigkeit und einem Mangel an Aufmerksamkeit zu tun; sie liegen in der Verfassung des welthaft existierenden Subjekts, das nur als ein solches zur intuitiven Erkenntnis befähigt sein kann und gegen die sich deshalb die Wirklichkeit dieser Erkenntnisart nicht darlegen läßt. Soll an einem endlichen Modus die Wirksamkeit Gottes aufgezeigt werden, muß diese Endlichkeit auch ernst genommen werden. Und Spinoza nimmt sie außerordentlich ernst. Er entwickelt dabei eine Fülle von Einsichten, welche Konsequenzen die Theorie der einen unbedingten Substanz für das Selbstverständnis eines endlichen Subjekts hat, das sich einerseits nicht ohne ein ihm logisch vorangehendes unbedingtes Prinzip adäquat begreifen kann, andererseits aber auch nicht gegen die Momente, die das Subjekt in dessen Endlichkeit bestimmen.
Es ist unverständlich, wie die deutschen Idealisten, Hegel nicht anders als Fichte und Schelling, von einem leblosen und starren System des Spinoza haben sprechen können, in dem nichts entwickelt werde und letztlich einem Akosmismus das Wort geredet werde. Verständlich wird es vielleicht, wenn man annimmt, daß sie nur den 1. Teil der Ethica gelesen haben. Ohne auf die einzelnen Etappen der Affektenlehre und die Struktur der intuitiven Erkenntnis hier eingegangen zu sein, habe ich demgegenüber wenigstens ansatzweise aufzeigen wollen, daß Spinozas Theorie der mens humana in den weiteren Teilen der Ethica sich als Theorie eines endlichen Modus lesen läßt, der sich fortentwickelt und einen Weg durchläuft, auf dem er zu immer höheren Stufen von Rationalität gelangt. Eine solche Theorie läßt sich gewiß als Beitrag zu einer Theorie von Subjektivität lesen. Zugleich kann man sie aber auch als Beitrag zu einer Theorie des Absoluten lesen, das funktional verstanden wird und seine Bedeutsamkeit aus einem von ihm selbst verschiedenen Endlichen erlangt, das ebenhierfür Subjekt sein muß, das durch Bewußtsein und Selbstbewußtsein gekennzeichnet ist.
In dem Aufsatz „Gedanken über Spinozas Lehre von der All-Einheit”13 hat sich Konrad Cramer vehement gegen eine mögliche pantheistische Deutung des Spinozismus gewandt und von dem Theorem, daß Alles in Einem sei, das Theorem, daß das Eine in Allem sei, fernhalten wollen. Mir scheint das nicht nötig zu sein. Der Verdacht, eine solche Position münde in eine mystische Schau der Indifferenz von Einem und Vielem und vernichte die Eigenbedeutsamkeit des Vielen, ist nicht gerechtfertigt. Umgekehrt verlangt eine Theorie der Eigenbedeutsamkeit des Vielen und damit des Einzelnen gerade dann, wenn beansprucht wird, deren Sein aus einem unbedingten Prinzip verständlich zu machen, daß dieses Prinzip als ein solches erwiesen wird, das sich an einem Einzelnen von diesem her ausweisen läßt. Hierfür ist zweierlei erforderlich: I. das Unbedingte muß in dem Einzelnen sein; 2. das Einzelne muß durch Wissen gekennzeichnet sein. Beide Bedingungen sind in dem Sinne unabhängig von einander, daß nicht die eine die andere impliziert. Das In-Sein Gottes in den Dingen ist nicht Folge irgend eines Wissens, das Gott zukäme. Und das Wissen, das dem Menschen zukommt, ist nicht Folge jenes In-Seins Gottes. Menschliches Wissen läßt sich im Ausgang vom Unbedingten, das nicht Geist ist und das nicht selber denkt, nicht gewinnen, auch nicht in der idealistischen Version von Stufen einer Selbstentfaltung des Unbedingten. Es zu thematisieren, verlangt einen Ausgang von dem Bedingten, von dem um einer angemessenen Theorie des Wissens willen zu zeigen ist, wie es als Bedingtes zu dem Unbedingten hingelangen kann. Ein solches Verfahren muß zu vermeiden suchen, der Gefahr zu erliegen, ebendamit das Unbedingte schon vom Bedingten her zu denken und somit als Unbedingtes zu verfehlen. Gleichwohl steht es in Spinozas Ethica unter einer subjekttheoretischen Prämisse, von der man aus einer anderen Perspektive, die meines Erachtens aber nicht die des Spinoza ist, sagen könnte, daß in ihr das, was das Unbedingte ist, verfehlt werde: daß das Reden vom Unbedingten nur in der menschlichen Perspektive eines Ausseins auf adäquates Wissen sinnvoll sei.
Spinozas Philosophie kann als eine Theorie gedeutet werden, die nachzuweisen versucht, daß für unser Denken, es in einem weiten Sinn gefaßt, ein von ihm verschiedenes Unbedingtes unabdingbar ist, das allem unserem Denken logisch vorangeht und gleichwohl eine funktionale Bedeutung im Hinblick auf es hat. Dieser Hinblick ist es dann, der über den Wahrheitsgehalt eines so konzipierten Unbedingten zu entscheiden hat. In einem Punkt hat Cramer allerdings völlig recht: daß unter der Annahme einer solchen Funktionalität das Programm einer letztbegründeten Rechtfertigung des Vielen aus dem Einen aufgegeben werden müßte.14 Ich glaube allerdings nicht, daß die Preisgabe des Gedankens einer zu fordernden Letztbegründung ein philosophischer Verlust ist. Von dieser Überzeugung geleitet, muß es erlaubt sein, Spinoza so zu lesen, daß seine Philosophie einer doppelten Perspektive verpflichtet ist, einer solchen, die von der Unbedingtheit Gottes ausgeht, und einer anderen, die von der Endlichkeit des menschlichen Geistes ausgeht, einer Zweiheit, die zusammenzuschließen das Programm dieser Philosophie ist. Dies gibt die Möglichkeit an die Hand, mit Spinozas Metaphysik des Absoluten auch eine Theorie des Subjektes zu verknüpfen, von der freilich noch zu fragen wäre, wie gehaltvoll sie in dem spezifisch spinozanischen Zusammenschluß ist. Auf jeden Fall sollte es nicht uninteressant sein, im Kontext von „Subjekt und Metaphysik" die Möglichkeit einer solchen Verknüpfung, die uns Spinozas Philosophie, recht interpretiert, bietet, zu verfolgen.11 Vgl. meinen Aufsatz: Unendlicher Verstand und menschliches Erkennen bei Spinoza. In: Tijdschrift voor filosofie 54 (1992), 492-521. hier: 504-509.
12 Zur Rolle, die das Subjekt dabei spielt, vgl. den Beitrag von Reiner Wiehl in diesem Band. 29-40.
13 In: All-Einheit. Wege eines Gedankens in Ost und West. Hrsg. von Dieter Henrich. Stuttgart 1985, 151-179, hier: 176-178.
14 Ebd 179
_________
Eerdere blogs over Wolfgang Bartuschat
5 november 2011 Bartuschat – niet eenvoudig, maar wel een verademing – bespreking van Baruch de Spinoza, van Wolfgang Bartuschat [2., aktualisierte Auflage 2006, oorspr. 1996]
5 november 2011 Wolfgang Bartuschat (1938-) Spinoza-deskundige met een eigen invalshoek en visie – nadere informatie.
6 november 2011 Een lemma over Spinozisme van Wolfgang Bartuschat dat hij schreef voor The encyclopedia of Christianity. Wm. B. Eerdmans Publishing/ Brill, 2008 (Vertaling van oorspr. Evangelisches Kirchenlexikon, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1986, 3e Auflage (Neufassung), 1997.
8 november 2011 Wolfgang Bartuschat – vervolg en nogmaals met een samenvatting van zijn Individuum und Gemeinschaft bei Spinoza, de uitgave van de voordracht die hij op 20 mei 1995 voor de Ver. Het Spinozahuis hield (Mededelingen 73, Eburon, Delft, 1996).
Hier Prof. em. Dr. Wolfgang Bartuschat publicatielijst